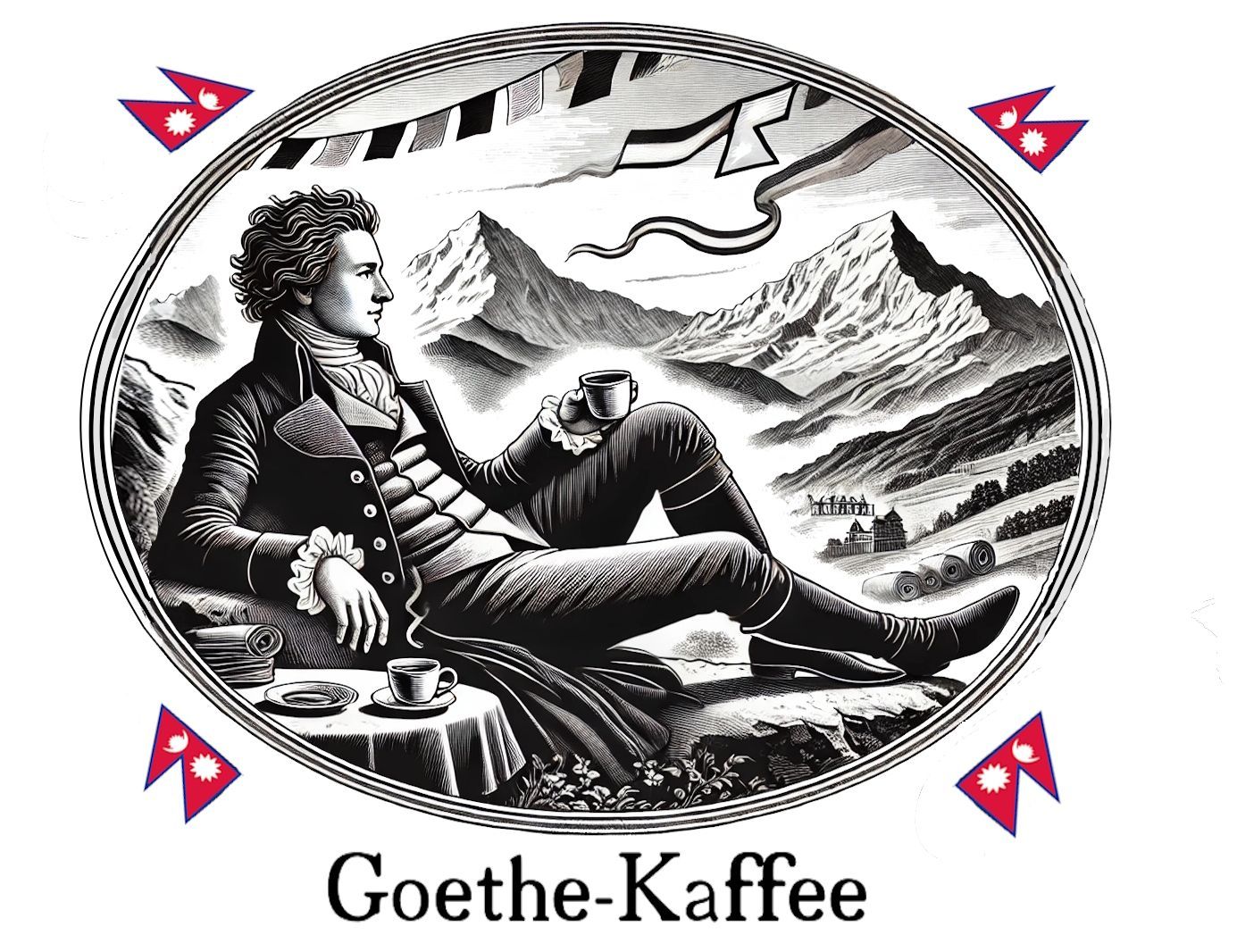
Ökologische und soziale Aspekte im Zusammenhang mit Kaffee
Rund ein Drittel des weltweit geernteten Kaffees wird in Europa konsumiert, und dort wiederum ist Deutschland
wichtigstes Abnehmerland. Kaffee ist der meistgehandelte Agrarrohstoff der Welt.
Die Menschen in Deutschland tranken z.B. im Jahr 2017 pro Kopf 162 l Bohnenkaffee, mehr als Wasser (148 l), Erfrischungsgetränke (116 l)
und Bier (102 l).
Die Art und Weise, wie wir in Deutschland Kaffee konsumieren, kann einen wesentlichen Einfluss auf das Weltwirtschaftssystem entwickeln.
Kaffee hat sich vom begehrten Luxusobjekt zum Allerweltsprodukt
entwickelt. Inflationsbereinigt ist der Preis für Kaffee in den vergangenen Jahrzehnten trotz starker Schwankungen durchschnittlich weit niedriger als in der Zeit vor 1989. Seit Ende 2016 liegt der Preis dauerhaft sehr niedrig, was die Situation für viele Bäuerinnen und Bauern noch einmal verschärft hat. Viele Familien leben deutlich unterhalb der Armutsgrenze
und sind nicht mehr in der Lage, selbst grundlegendste Ausgaben, zu decken, geschweige denn für eine angemessene Schulausbildung
der Kinder zu sorgen. Die Internationale Kaffeeorganisation geht davon aus, dass als Folge des Preisverfalls die Zahl der arbeitenden Kinder
im Kaffeesektor gestiegen ist .

Wie aufwendig der Anbau und die Weiterver-arbeitung von Kaffee sind, haben wir hier
beschrieben.
Daraus
leitet sich zwingend ab, dass bei einem Preis beim Discounter in Deutschland von teilweise unter 10 € je kg Kaffee eine faire Bezahlung der Kaffeebauern nicht gegeben sein kann, ganz gleich, in welchem Maße die Verarbeitungs- und Lieferketten optimiert sind.

Leider muss man konstatieren, dass entlang der gesamten Lieferkette grundlegende Menschenrechte, wie sie vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in den 2011 verabschiedeten „Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ aufgestellt sind, missachtet
werden. Ähnlich wie beim Spargelanbau leisten wir uns einen Genuss zulasten der Landarbeiter und Bauern, jedoch in weit höherem Maße.
Wege zur Minderung der sozialen Probleme
Alleine schon in Folge der Topografie des Landes findet in Nepal ein großer Teil des Anbaus in kleinräumlicher Terrassenwirtschaft statt, die von Kleinbauernfamilien betrieben werden. Zahlen zu Nepal liegen uns nicht vor, aber weltweit bestreiten mindestens 12 Mio. Familien
einen erheblichen Teil ihres Einkommens mit dem Anbau von Kaffee auf Kleinfarmen und weitere 12 Mio. Familien, die von den Lohnzahlungen auf großen Plantagen abhängig sind, besonders in Anbauländern wie Brasilien. Die
Preisentwicklung beim Kaffee prägt somit die Lebenssituation großer Bevölkerungsteile weltweit und zunehmend auch in Nepal.
Hinzu kommt, dass im internationalen Vergleich Nepals Kaffeebauern gut bezahlt werden, seit der Staat einen Mindestlohn festgelegt hat. Die Entlohnung liegt bei knapp dem Dreifachen dessen, was die meisten Zertifizierungen vorschreiben.
Die mit kar.ma COFFEE, der Bezugsquelle unseres Goethe Kaffees, zusammenarbeitenden Bauern und Kooperativen werden noch einmal deutlich besser bezahlt, bis zum Doppelten des vorgeschriebenen Mindestlohns.

Und es kommt noch besser:
Entlang der Lieferkette von der Erzeugung bis zum Verbrauch werden umfangreiche Beträge für soziale Projekte abgeführt. Der Beitrag zur sozialen Verträglichkeit beginnt mit der guten Bezahlung der Bauern, setzt sich fort in einem Bildungsprojekt in einem der "Kaffeedörfer" und endet mit den von "Goethe hilft mit e.V." geförderten Projekten zur Bildung von jungen Frauen und Mädchen in Nepal.

Ökologische Herausforderungen
Mit dem Kaffeeanbau und dessen Verarbeitung sind etliche ökologische Problemfelder verbunden, denen je nach Anbauland, Region und Plantagengröße sehr unterschiedliches Gewicht zukommt. Sie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
- Entwaldung, Umwandlung von Primärwäldern
- Verlust von Biodiversität und Zerstörung von Habitaten
- Bodenerosion und Bodendegradation
- Nutzung und Abfluss von Chemikalien
- Beeinträchtigung der Wasserqualität und der Wasserversorgung
- Unzureichendes Abwassermanagement
- Eutrophierung
- Krankheiten und Schädlinge
- Monokulturen und fehlende Schattenpflanzen
kar.ma COFFEE
arbeitet ausschließlich mit Farmern zusammen, die ökologisch düngen. Die Plantagen sind sehr klein und die Kaffeebauern achten darauf, dass die Kaffeepflanzen im Halbschatten größerer Bäume gedeihen. Viele der oben genannten Probleme treten deshalb systembedingt schon gar nicht auf.
Bleibt das Thema Abfall:
Im Kaffeeproduktionsprozess entstehen Abfälle wie Fruchtfleisch und Schalen, die
soweit wie es geht wiederverwendet werden. Aus dem
Fruchtfleisch werden zum Beispiel Öko-Druckservietten
und Recyclingpapier
hergestellt, der extrahierte Kaffeesatz
aus vor Ort konsumierten Kaffee wird als Düngemittel
verwendet.
Damit ergeben sich auch zusätzliche Einnahmequellen für Bauern und Handwerker, der Kreis schließt sich.

Ein paar Worte zu Zertifizierungen und anderen freiwilligen Standards
In den vergangenen 20 Jahren haben viele freiwillige Initiativen versucht, die Situation der Kaffeebauern
zu verbessern, z.B über Zertifizierung durch Standardsysteme (Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance, Bio Zertifizierungen). Auch viele große Kaffeeunternehmen führten unter erheblichem finanziellen Einsatz eigene Projekte durch, und versehen den Kaffee dann mit unternehmenseigenen Labels (z.B. C.A.F.E. Practices von Starbucks oder AAA von Nestlé).
Studien zur Prüfung, welche Vorteile eine Zertifizierung
für die Plantagenbetreiber bringt, liefern keine eindeutigen Ergebnisse. Grundsätzlich sorgt eine Zertifizierung für mehr Transparenz hinsichtlich der Herkunft
der Kaffeebohnen und zu ökologisch verträglicheren Anbaupraktiken. In einzelnen Gebieten gab es Belege dafür, dass die Einkommen der Bauern stiegen, auch weil sie besseren Zugang zu Krediten bekamen.
Andererseits erfassen die standardsetzenden Organisationen die ärmsten und nicht organisierten Bäuerinnen und Bauern nicht. Oft sind die Farmer aufgrund der lokalen Gegebenheiten nicht in der Lage, die Anforderungen der standardsetzenden Organisationen zu erfüllen.
Da die Kosten für Zertifizierungen und Audits sehr hoch
sind und von den Kaffeebauern selbst getragen werden müssen, bedeutet das insbesondere für die Kleinbetriebe Nepals mit einer Anzahl zwischen 5 und 50 Kaffeebäumen ein erhebliches Risiko, weil es im Rahmen der meisten Verträge keine Absatzgarantie gibt. Dann sind sie gezwungen, den Kaffee über den konventionellen Markt zu verkaufen, der stark von Niedrigpreisen geprägt ist und die Zusatzkosten nicht abdeckt.
Wie begrenzt die Wirkungen von Zertifizierungen sind, zeigt sich daran, dass gegenwärtig rund 50 % der weltweiten Kaffeeernte in irgendeiner Form zertifiziert
ist, zugleich jedoch Armut, Kinderarbeit und ökologische Probleme immer häufiger auftreten. Tatsächlich haben die Nachhaltigkeitsansätze nur geringe Auswirkungen auf die Einkommen der Landwirte. Lediglich 0,6 % des Branchenumsatzes werden derzeit als Prämie für zertifizierte Produkte ausgezahlt.
Als Fazit bleibt die Feststellung, dass die Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen wie auch der von ihnen gegründeten Verbände weitgehend gescheitert sind.
Es ist grundsätzlich schwierig, die Wirksamkeit von Zertifizierungen nachzuweisen, da sie nicht von ohnehin stattfindenden Veränderungen auf dem Markt zu abzugrenzen sind.
Unser "Goethe Kaffee" trägt aus den oben genannten Gründen kein Zertifizierungslabel. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass durch die Wahl unseres Kooperationspartners kar.ma COFFEE das Ziel, die Situation der Kaffeebauern zu verbessern, erreicht wird.
Unser "Goethe Kaffee" trägt aus den oben genannten Gründen kein Zertifizierungslabel. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass durch die Wahl unseres Kooperationspartners kar.ma COFFEE das Ziel, die Situation der Kaffeebauern zu verbessern, erreicht wird.
Denn kar.ma COFFEE
unterstützt die Bauern bei der Entwicklung neuer Produkte, bietet Schulungen zum Einsatz moderner Technologien
an und hat zusammen mit einem Fintech-Unternehmen ein digitales Zahlungsmodell
eingeführt. Dies ermöglicht es den Händlern, jede Transaktion an Bauern und Pulper freizugeben und zu überwachen. So ist sichergestellt, dass jeder Kaffee, der bezogen wird, die gewünschte Qualität und Quantität aufweist. Die Bauern können Vorauszahlungen von Finanzinstituten erhalten, die sie in ihren Mikrounternehmen für Investitionen nutzen können.
Damit wird die Interaktion zwischen Kaffeebauern und -verarbeitern in abgelegenen Dörfern und den Käufern deutlich verbessert, wodurch eine langfristige Beziehung zwischen allen Beteiligten aufgebaut und das Wachstum des gesamten Kaffeesektors unterstützt wird.
Quellenangaben
Die auf dieser Seite wiedergegebenen Informationen stammen
- im Wortsinn vom Institut für Ökonomie und Okumene https://www.sustainable-supply-chains.org/fileadmin/INA/Wissen_Werkzeuge/Studien_Leifaeden/Einsteiger/2020-01_Studie_Auf_ein_Taescchen_Die_Wertschoepfungskette_von_Kaffee.pdf
- von der Website von kar.ma COFFEE https://karmacoffee.com.np/
- vom Internetauftritt der Namaste Nepal S-AG https://www.nepalbuchen.de